
Ein langes Leben oder länger arbeiten? Die Folgen des demographischen Wandels sind vielfältig. Doch trotz zahlreicher Reformen der vergangenen Jahre blicken die Deutschen mit Sorge auf den Bevölkerungswandel. Die meisten Bürger sehen wichtige Fragen unbeantwortet und fürchten einen sinkenden Wohlstand nach Renteneintritt. Erkennbar wird aber auch ein Mentalitätswandel mit deutlichem Trend zu mehr Arbeit im Alter.
Steigende Lebenserwartung und sinkende Geburtenraten: Die Deutschen sehen die Folgen dieses sogenannten demographischen Wandels mit Skepsis: Fast zwei Drittel (65 Prozent) verbinden damit vor allem Risiken. Nicht mal jeder Zehnte (8 Prozent) sieht darin Chancen für Deutschland. Auslöser dafür sind vor allem Sorgen um den Wohlstand und die Lebensqualität zum Lebensabend: Altersarmut, erhöhte Lebensarbeitszeiten und steigende Rentenbeiträge stehen bei den Deutschen ganz oben auf der Sorgenliste. Gleichzeitig zeigt sich: Immer mehr Menschen sind bereit, im Alter länger zu arbeiten. Die Motive dafür hängen allerdings von Einkommen und Bildungsgrad ab.
Zu diesen Ergebnissen kommt eine repräsentative Bevölkerungsumfrage der Bertelsmann Stiftung. Dafür hat das Institut für Demoskopie Allensbach 1.400 Personen ab 16 Jahren zum Thema demographischer Wandel befragt.
Seit 2014 hat sich die Zahl der Menschen erhöht, die den demographischen Wandel eher als Risiko für Deutschland wahrnehmen (2014: 55 Prozent; 2017: 65 Prozent). Gleichzeitig sehen immer weniger Bürger den Wandel als Chance (2014: 11 Prozent; 2017: 8 Prozent). Als erwartete Folgen des demographischen Wandels nennen die Deutschen besonders häufig: steigende Altersarmut (83 Prozent), einen späteren Renteneintritt (80 Prozent) und steigende Rentenversicherungsbeiträge (77 Prozent).
Während zur Jahrtausendwende noch mehr als die Hälfte der berufstätigen Befragten (2002: 52 Prozent) früher als gesetzlich vorgesehen in den Ruhestand gehen wollte, hat sich ihr Anteil auf aktuell 25 Prozent mehr als halbiert. Dagegen hat sich die Anzahl der Berufstätigen, die über die Ruhestandsgrenze hinaus arbeiten wollen, im selben Zeitraum verdoppelt (2002: 5 Prozent, 2017: 12 Prozent). Dabei sind die Beweggründe für eine längere Erwerbstätigkeit von der sozioökonomischen Situation der Befragten abhängig: Je höher Qualifikationsniveau und Haushaltseinkommen, desto eher spielen Motive wie „Freude an der Arbeit“ und „Kontakt mit Menschen“ eine Rolle. Je niedriger Einkommen und Qualifikationsniveau, desto eher sehen die Befragten längeres Arbeiten als finanzielle Notwendigkeit und weniger als sinnstiftende Chance.
Neueste Artikel von Rolf Dindorf (alle ansehen)
- Demographischer Wandel im Vergleich: Indien und Deutschland - 19. April 2024
- Demographischer Wandel in Deutschland – die Uhr tickt - 10. April 2024
- Wie lässt sich der Austausch zwischen Babyboomern und Generation Z fördern? - 10. März 2024
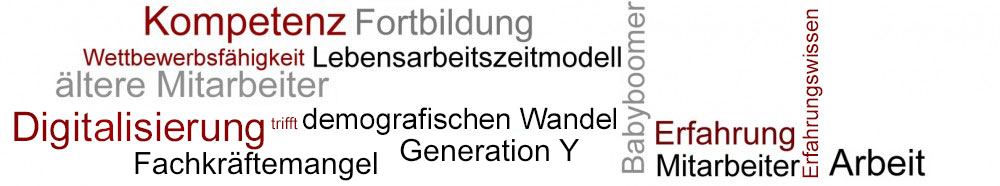

Kommentar verfassen